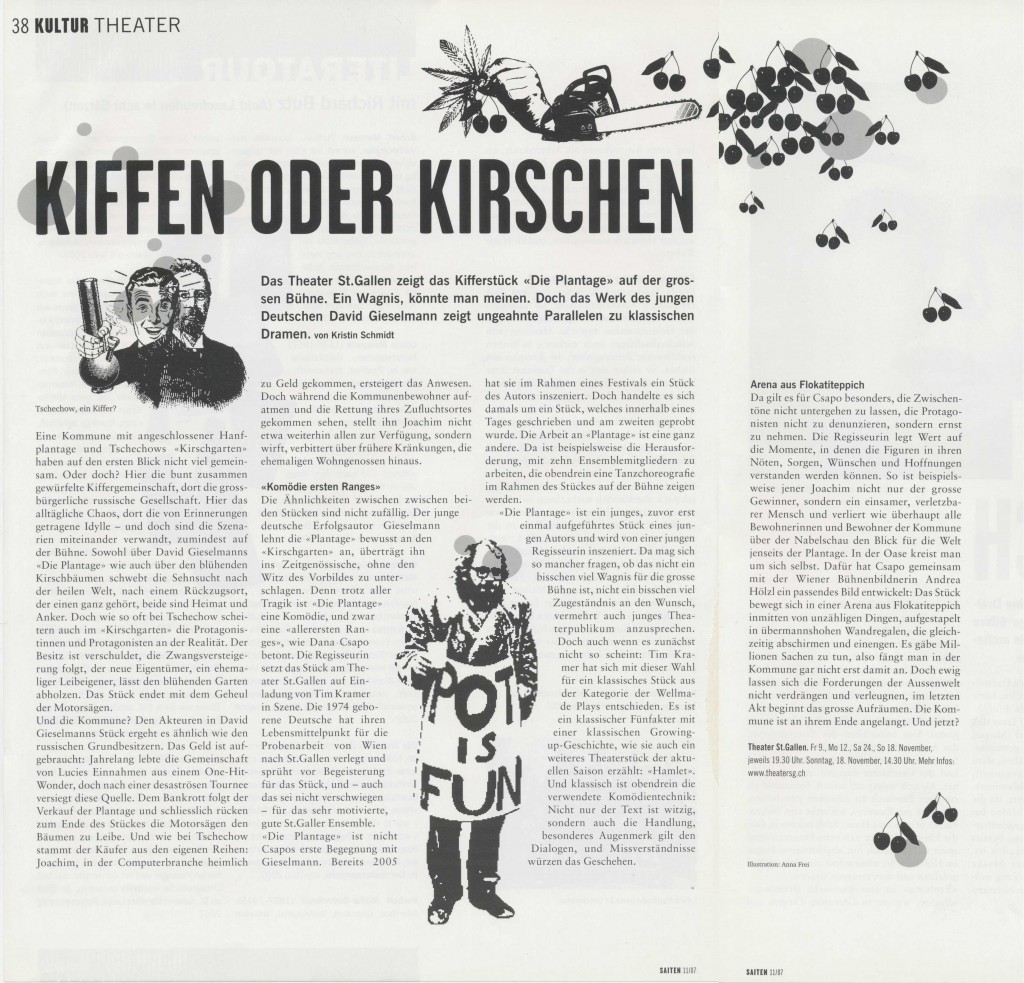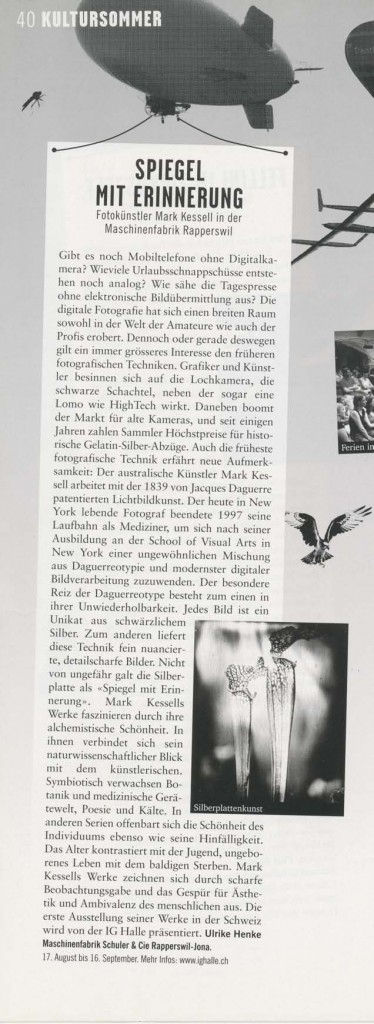Leere und Fülle
Ein grösserer Kontrast lässt sich innerhalb der Räume der Neuen Kunst Halle kaum denken: hier die grosse Leere, ein Ausstellungsort ohne Ausstellungsgegenstände, kahle Wände – dort dicht gefülltes Raumvolumen, ein Labyrinth aus Stützen, dicht und unzählbar.
Von Dezember bis Januar zeigt die Neue Kunst Halle St. Gallen zwei Ausstellungen zeitlich und räumlich parallel, die jede für sich eigenständige Präsentationen sind. Und wie um dies zu untermauern, bilden sie ein eindrucksvolles Gegensatzpaar. Dies gilt nicht für den Raumeindruck, sondern auch für die kuratorische Ausgangssituation: Einerseits ist die Baslerin Sonja Feldmeier in einer Einzelausstellung zu sehen, andererseits lädt der eingeladene Londoner Gastkurator Mathieu Copland selbst Künstler ein.
Das Besondere ist bei letzterer Situation, dass diese Künstler nicht gleichzeitig ausstellen, wie sonst bei Gruppenausstellungen üblich. Eigentlich stellen sie sogar überhaupt nicht aus, zumindest nicht, wenn man von herkömmlichen Kunstkategorien ausgeht und Objekte oder Bilder erwartet. Statt dessen sind Bewegungsperformances zu sehen: Für die gesamte Dauer der Ausstellung werden drei Mitglieder der Tanzkompanie des Theaters St. Gallen jeweils von Mittwoch bis Sonntag für vier Stunden in der Neuen Kunst Halle agieren. Sie führen Sequenzen aus, die von den Künstlern der Ausstellung erarbeitet wurden. Über sechs Wochen hin fügt sich Stück an Stück bis am Ende eine Gesamtkomposition entstanden ist. Wohl kaum einer wird dann jedes einzelne Werk gesehen haben, und doch ist auch jede einzelne Position für sich sehenswert. Da ist zum Beispiel Roman Ondaks Beitrag «Insiders», der sprichwörtlich das Innere nach Aussen kehrt und die Darsteller ihre Kleider verkehrt herum tragen lässt, während sie die Betrachter völlig zu ignorieren scheinen. Karl Holmquist hingegen lässt in der «Polyphonie von Stimmen» die Mitwirkenden Liedtexte lesen und dazu Putzgebärden vollführen, während Michael Parsons mit seinem bereits 1968 entwickelten Stück «Walking Piece» optische Musik erzeugen wird.
Indem Copland diesen Performanceklassiker integriert, zeigt er, dass die Idee, im Kontext der Kunst auf dauerhafte, materiell existente Werke, ja sogar auf jegliche Requisiten und sogar Musik zu verzichten, durchaus nicht neu ist. Tino Seghal erregt seit wenigen Jahren viel Aufsehen mit seinen Stücken, nicht zuletzt aufgrund seiner Verweigerung jeglicher Dokumentation in Wort und Bild. Der Kunstbetrachter kann Seghals Stücke nur live vor Ort oder gar nicht erleben, und es bleiben keinerlei Artefakte übrig, weil von vornherein nichts ausser der Präsenz der Ausführenden zum Einsatz kommt. Doch auch dieser radikale Ansatz hat Vorläufer. Genauso auch die Idee, die Grenzen zwischen Bildender und Darstellender Kunst zu sprengen. Merce Cunningham etwa arbeitete sehr eng mit Künstlern zusammen.
In der Neuen Kunst Halle sind ebenfalls Tänzer und Choreografen mit von der Partie, so etwa Philipp Egli, der Leiter der Tanzkompanie des St. Galler Theaters oder der New Yorker Choreograf Jonah Broker, der Computer und Tanz zusammenbringt. Coplands «choreografierte Ausstellung» zeigt Grenzüberschreitungen also auch innerhalb der einzelnen Gattungen.
Dies gilt – bei allen formalen Gegensätzen – auch für die Werke der Baslerin Sonja Feldmeier. Hat der Ausstellungsbesucher den grossen Raum der Neuen Kunst Halle und damit die von den Tanzenden gefüllte Leere passiert, erwartet ihn in den beiden folgenden Räumen eine dichte Mischung von Ton, Bild, Installation und Objekt. Doch zunächst sind da die alles beherrschenden Baustützen. Verrostet und verschmutzt, mal enger und mal weiter zusammenstehend ragen sie vom Boden bis zur Decke auf. Schon in diesem Bild verbirgt sich eine gewisse Ambivalenz, denn solche Stützen werden sowohl eingesetzt um neue Architektur zu bauen, als auch um marode, alte Konstruktionen zu stützen. Auf- oder Abbruch ist hier die Frage. Aber genauso lautet sie: Innen oder Aussen? Geborgenheit oder Enge? Tristesse oder Romantik? Einatmen oder Ausatmen? Die Künstlerin nennt ihre Ausstellung «Inhale Exhale» und zeigt bereits darin, dass das eine das andere nicht ausschliesst, sondern bedingt. Sie knüpft ein vieldeutiges Netz aus Zeichen, Bildern und Anspielungen. Die Stützen werden spätestens dann zum Wald, wenn sich eine Lichtung auftut oder echte Baumstümpfe ins Blickfeld kommen. Doch auch diese sind nicht nur das, was sie zu sein scheinen, denn aus ihnen ertönen Radiogeräusche. Zwischen dem Sendersuchlauf tönt immer wieder das von Laien intonierte «I did it my way» heraus.
Feldmeier untersucht Kommunikationswege und -prinzipien und richtet das Augenmerk gleichzeitig auf die Personen hinter der Stimme, der Musik oder dem Schleier. Ob sie Personen nur hören lässt, Hände beim SMS tippen zeigt oder eine verschleierte Frau mit einem Schlagzeug spielen lässt, immer bietet Feldmeier durch Auslassungen den Akteuren genügend Raum und somit auch den Betrachtern ausreichende Projektionsflächen. Sie sollen und dürfen ihre Wahrnehmungsmuster und Rollenklischees überprüfen oder noch besser ablegen und wieder neu hinsehen.