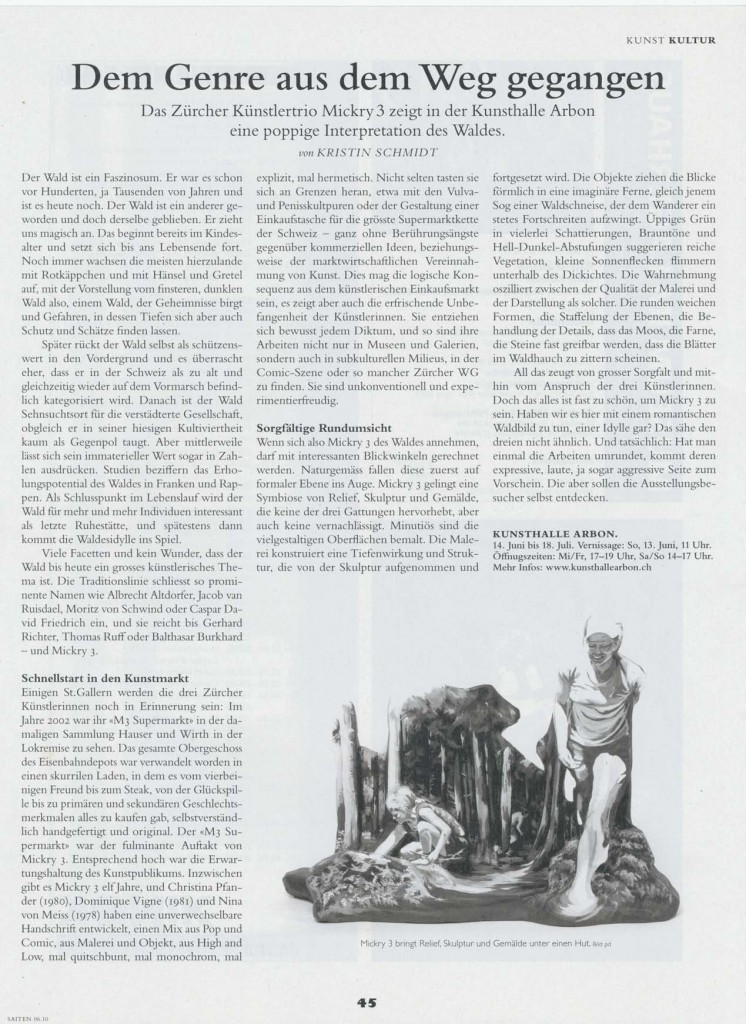Ulrike Kristin Schmidt
Juni 1, 2010
Mai 28, 2010
St. Gallen und die weite Welt
Ingo Giezendanner realisiert das Kunst-am-Bau-Projekt für das neu gebaute Schulhaus Schönenwegen. Er oszilliert in seinen Arbeiten zwischen verschiedenen Ebenen und hat keine Berührungsängste, was den Ort dieser Kunst angeht.
Kunst im öffentlichen Raum hat viele Aufgaben zu erfüllen. Sie soll ihre Umgebung auf-, um- oder neubewerten, soll zur ästhetischen Bildung ihrer Betrachter beitragen und die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen. Aber nur, wenn sie gut ist, dringt sie ins Bewusstsein der Adressaten vor und behauptet sich dort. Ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann, entsteht derzeit im Schulhaus Schönenwegen.
Ingo Giezendanner hat 2008 den Kunst-am-Bau-Wettbewerb für den Neubau des Schulhauses für sich entschieden. Und es ist Teil des künstlerischen Konzeptes, dass nicht erst jetzt, kurz vor der Eröffnung, etwas von Giezendanners Arbeit zu sehen ist: Das Werk besteht aus mehreren Teilen, von denen zwei bereits im Herbst vergangenen Jahres realisiert wurden. Weiteres kam im Winter hinzu, weiteres wird zur Schulhauseröffnung installiert.
Wer zu den zahlreichen Passanten der Zürcher Strasse gehört, dem wird es längst aufgefallen sein: Das Wandbild an der Ostfassade des Schulhauses. Auf der makellosen Sichtbetonwand beginnt es in der rechten unteren Ecke bereits zu bröckeln. Das Wandgemälde zeigt eine in sich zusammengefallene Mauer und ist eines jener Motive, die Giezendanner auf Reisen mit schwarzem Stift auf Papier bannt.
Von Uganda bis Georgien, von Pakistan bis Spanien, von Aserbaidschan bis Sri Lanka reichen seine zeichnerischen Tagebücher. Doch nur dem Eingeweihten offenbart sich der genaue Ort, die direkte Vorlage eines einzelnen Blattes. Für alle anderen überwiegt die Lust am Schauen, an der unendlichen Vielfalt der Motive, am zeichnerischen Können des Künstlers, seiner Strichführung, der Komposition.
Auch die Vorlage des Wandgemäldes am Schulhaus Schönenwegen ist nur sekundär von Interesse, wichtiger ist das bewusst gesetzte Spannungsfeld von glatter Oberfläche und abgebildetem brüchigem Mauerwerk. Zudem leitet das Motiv in den Innenraum des Gebäudes über, denn rückseitig befinden sich die Bibliothek des Schulhauses und ein weiteres Wandgemälde Giezendanners. Im Kontrast zur zerfallenen Steinmauer umwuchert hier dichtes Laubwerk ein intaktes Baumhaus. Die Vorlage dafür zu identifizieren ist nun für keinen Betrachter schwierig; schwenkt er seinen Blick, erkennt er durch die Fenster hinaus gegenüber der Rückseite des Schulhauses eben jenes Baumhaus im Original.
Dies ist ein weiterer Reiz der Arbeit Giezendanners: das Oszillieren zwischen bekannt und unbekannt, nah und fern, vertraut und exotisch. Nicht nur von Auslandsreisen bringt der Zürcher seine Handzeichnungen mit, sie entstehen auch im allernächsten Umfeld. Auf dem Baumhauswandbild wiederum sind sie vereint: Originalzeichnungen aus Islamabad, Tiflis, Amsterdam, Sarajevo, Istanbul, Kairo oder New York und Kopien von Zeichnungen aus St. Gallen, Zürich und anderswo.
Nicht nur die Motivvielfalt fesselt die Aufmerksamkeit, es ist auch das Spiel aus Mikro- und Makrostruktur, aus kleinsten Rastern bis hin zu freien Flächen. Der alleinstehende Strich kontrastiert mit Liniengewebe, das weisse Papier mit Grauwerten, die allein aus dicht gesetzten Pattern entstehen. Und wer meint, alles auf dieser Bibliothekswand gesehen zu haben, für den hat Giezendanner gesorgt. Teil der Arbeit ist ein Netzwerkdrucker, der während fünf Jahren ein bis zweimal pro Woche eine Zeichnung ausspuckt. Der Künstler füttert den Drucker sowohl mit Archivmaterial als auch mit aktuellsten Zeichnungen seiner Reisen. Und so rücken die Welt und St. Gallen einmal mehr zusammen. Gelungen ist dabei auch die Verbindung zum Schulhaus, vereint es doch Schüler aus aller Welt.
Ingo Giezendanner hat keine Berührungsängste, sowohl das schulische Umfeld seiner Arbeit als auch die Verwendung der ausgedruckten Zeichnungen betreffend. Ob als Arbeitsmaterial, Notizpapier, gehängt, mit nach Hause genommen oder vollgemalt – alles ist denkbar und in jedem Falle eine Bereicherung des schulischen Alltages.
April 22, 2010
Rätselhafte Rebusse
Andrea Giuseppe Corciulo präsentiert seine aktuellen Gemälde in der Galerie Paul Hafner. Ausgangspunkt der Bilder sind freie Bildassoziationen des Künstlers.
Der Finger fährt über die Seiten und Wörter eines Fremdwörterlexikons, und das Wort, bei dem er auf ein verabredetes Signal hin stehenbleibt, wird zum Ausgangspunkt für meistens recht gewagte Übersetzungen – ein beliebtes Gesellschaftsspiel, nicht nur deshalb, weil die schlagfertigsten Teilnehmer mit ihren Deutungen zur Unterhaltung beitragen, sondern auch, weil sich immer wieder zeigt, wie gross und vielseitig der Bereich des Unbekannten ist.
Ähnlich mag es dem Besucher der jüngsten Ausstellung bei Paul Hafner gehen. Wer hätte gewusst, dass es sich bei «Ekibastus» oder «Tuxpanguillo» um einen sibirischen und einen mexikanischen Ortsnamen handelt?
Andrea Giuseppe Corciulo verwendet sie als Bildtitel für zwei seiner aktuellen Gemälde. Das Fremdartige des Titels spiegelt sich in den Sujets: Vor Hähnen aus Ton sitzt in schwarz-weiss gestreifter Kleidung ein Mann mit feinem Malerpinsel in der Hand. Sein Kopf ist beschnitten, ebenso wie sein linker Arm und der gesamte Unterkörper. Sofort beginnt im Kopf des Betrachters die Assoziationskette anzulaufen: Sibirien und Häftling, das liegt nahe, Pinsel und Keramik auch, doch ein Gefangener, der Hähne glasiert? Und warum sind die Hähne um 90 Grad gedreht?
Der St. Galler Künstler hat bereits in früheren Serien gezeigt, dass er ein Meister der Verrätselung ist. In der Ausstellung «Congrès international de folklore» erlebt sein virtuoses Spiel mit Andeutungen und Motiven einen neuen Höhepunkt. Zwar taucht immer wieder Bekanntes auf, doch die Zusammenstellungen sind mirakulös, vieldeutig und hintergründig. Ein modernistischer Häuserblock vor Ziereule, ein Pferd vor Schmuckteller mit rosa Wolkenform, Textilfragmente vor Männerporträts – es lässt sich keine Erklärung finden.
Das birgt die Gefahr, dass der Betrachter sich ratlos abwendet, doch dies weiss Corciulo auf zweierlei Weise zu verhindern. Gelingt es zwar nirgends, ein Gemälde vollständig zu entschlüsseln, so gibt es doch immer wieder Versatzstücke, die auf eine vermeintlich bekannte Fährte locken und die Aufmerksamkeit fesseln. Wer zum Beispiel könnte das gekrönte Haupt in «Tuxpanguillo» sein? Und die Figur davor? Ein Luchador, ein Cowboy oder beides? Und dann die anderen Bildtitel: «Volksmedizin» oder «Erdaufschliesser», «Graskönig» oder «Märchenerzähler» – schon wieder ist der Betrachter gefangen genommen von der suggestiven Kraft der Werke. Sie laden zu individuellen Assoziationsketten ein.
Die andere Stärke der Bilder liegt in ihrer Ästhetik. Nicht nur in der inhaltlichen Kombination der Motive, sondern auch im Spiel von gross und klein, farbig und monochrom, Ausschnitt und Gesamtansicht, Detailreichtum und Fläche. Oft ist der Hintergrund neutral gehalten, was die Motive umso stärker hervortreten lässt. Sie wiederum werden gedreht, angeschnitten, verdeckt und multipliziert. Kontraste werden geschaffen und wieder aufgehoben.
In fotorealistischer Manier legt Corciulo eine Unschärfe über alle seine Gemälde. Die Konturen wirken leicht verschwommen und so sind die dargestellten Dinge weniger stark gegeneinander und gegen den Hintergrund abgegrenzt. Wo jedoch der Fotorealismus dazu neigt, die Bildoberfläche so zu behandeln, dass sie schliesslich steril, leblos wird, ist bei Andrea Corciulo auch die Malerei selbst, der Duktus noch Thema.
April 20, 2010
Grüner geht’s nicht
In der Galerie Christian Röllin sind aktuelle Arbeiten von Jos van Merendonk zu sehen. Der Amsterdamer Künstler zeigt in St. Gallen die Weiterentwicklungen seines monochromen Werkes.
Wissenschafter der Universität Columbo in New York haben es herausgefunden: Grössere Auswahl bedeutet nicht grösseres Glück. Im Gegenteil: Die Ausweitung der Wahlmöglichkeiten erhöht die Chance einer Fehlentscheidung und damit die potenzielle Unzufriedenheit mit der tatsächlich getroffenen Wahl. Es ist stets zu befürchten, eine bessere Entscheidung wäre möglich gewesen.
Ein beschränktes Angebot wirkt sich demnach positiv auf das Befinden aus. Was für die Konsumwelt nur allzu offensichtlich gilt, lässt sich auch in die Kunst übertragen, zumindest, angesichts des Werkes des Jos van Merendonk. Der niederländische Künstler beschränkt sich in der Anzahl der Optionen – und gewinnt gerade dadurch umso grössere Freiheit. Immer beginnt Jos van Merendonk seine Bilder auf quadratischem Format mit einem Bleistiftraster aus gezeichneten Oval und einer Zickzacklinie von links oben nach rechts unten, und er kommt – was noch viel augenfälliger ist – stets mit ein und derselben Farbe aus: Chromoxidgrün. Und dies seit über 20 Jahren.
Wer jedoch meint, dass dies zwangsläufig in gepflegte Langeweile führe, der wird in der aktuellen Ausstellung in der Galerie Christian Röllin eines Besseren belehrt. Das Werk bleibt spannend; und neue, unerwartete Entwicklungen wirken geradezu selbstverständlich.
Der erste Blickfang ist eine Serie mit ausgespartem Grundraster. Die weisse Grundierung in der offen gearbeiteten grünen Fläche verleiht dem Werk kristalline Fragilität und Strenge zugleich. Während hier Reminiszenzen an die Frühmoderne offensichtlich sind, sind bei den pastos gemalten Werken andere Akzente gesetzt. Faszinierend hier, welche Welten ein kleines Format im Vergleich zu einem riesenhaften öffnen. Das Kabinettstück erinnert in seiner Dichte an Altdorfer’sche Landschaften, das Grossformat hingegen zeigt Variationen über ein Thema: Der Farbauftrag reicht von lasiert bis aufgespachtelt, die Technik von der Abtragung bis zur Collage. Spätestens hier zeigt sich auch die ausgetüftelte Hängung in der Galerie. Vor der weiss getünchten unverputzten Wand und im Streiflicht wirkt die Struktur des Bildes noch plastischer.
Galerist und Künstler arbeiten gezielt mit der räumlichen Situation, die eben auch ganz verschiedene Wandoberflächen einschliesst – bis hin zur ungeweisselten Nische mit Oberlicht. Hier hängt eines der neuen Reliefs des Künstlers. Sie sind eine Weiterentwicklung der Gemälde, allerdings eine mit weiterem Potenzial. Der Reiz der Reliefs liegt in ihrer Konstruktion und der Materialität, die jedoch durch die vielseitige Bemalung etwas überlagert wird, hier wäre weniger mehr. Denn räumliche Tiefe allein vermag Merendonk bereits in seinen Bildern zu erzeugen, legt er doch Schichtungen übereinander oder konstruiert allein durch den Farbauftrag fensterartige Durch- oder Ausblicke.
Besonderes Augenmerk zieht das Wandgemälde mit integrierten Tafelbildern auf sich. Es ist immer bereichernd zu sehen, wie Künstler mit eigens erstellten Arbeiten auf Ausstellungssituationen reagieren. Hier oszillieren Hinter- und Vordergrund, beides ist gleich gewichtet im Wechselspiel breiter Streifen oder dynamischer Schlängellinien.
Noch sind frühere Präsentationen des Künstlers bei Christian Röllin im Gedächtnis, und es lohnt sich auch jetzt wieder hinzusehen. Dabei bleibt im Hinterkopf stets die Frage: Ist das alles nun interessant wegen der beschränkten Mittel oder trotz ihnen? Wie auch immer die Antwort ausfallen mag, Jos van Merendonk nutzt die Chance der reduzierten Auswahlmöglichkeiten im besten Sinne.
März 9, 2010
Isabellas Leiden
Percussionist Markus Lauterburg und Tänzerin Beatrice Im Obersteg präsentieren das neue Stück des Ensembles «Distanz» im Pfalzkeller. Es thematisiert, hochästhetisch, den Umgang mit traumatischen Erfahrungen.
Ein leises Klingeln durchzieht den Raum. Das Publikum trifft gerade erst ein, und schon wird es gefangengenommen von der gleichermassen vertrauten wie fremdartigen Geräuschkulisse. Ein automatisches Glockenspiel aus Porzellan-Schüsselchen bildet den Auftakt zu Beatrice Im Oberstegs und Markus Lauterburgs neuem Tanztheaterstück «Isabella».
Wie so oft bei den Stücken des Ensembles «Distanz» beginnt die Aufführung vor ihrem eigentlichen Auftakt.
Beide Künstler verharren regungslos auf der Bühne und sind doch präsent; Markus Lauterburg am Schlagzeug und Beatrice Im Obersteg auf einem Rondell stehend, von Gurten gehalten und von einem weissen durchscheinenden Gewand umhüllt.
«Isabella» besticht von der ersten Sekunde an durch die hohe ästhetische Durcharbeitung, die bei dem vor fünf Jahren gegründeten Ensemble bereits Programm geworden ist. Das Zusammenspiel von Musik, Licht und getanztem Bild erfährt diesmal allerdings noch eine Steigerung durch den Raum selbst, der bei «Distanz» immer Teil der Choreographie ist. Der Pfalzkeller mit seinen gestreckten, flach gerundeten Pfeilern bildet denn auch die ideale Kulisse für «Isabella». Hier wie dort dominieren makelloses Weiss und perfekte Form. Und wenn sich Beatrice Im Obersteg, gehalten von den Gurten, aufbäumt, fallen lässt oder streckt, geht ihre Körperspannung mit der Spannung des Raums geradezu eine Symbiose ein.
Zu Beginn des Stücks dominieren Gesten des Abstreifens, Abwehrens, Befreiens. Mal wirken die Gurte und der darüber gebreitete Stoffkegel wie ein Käfig, mal wie ein Schutz; mal verwandeln sie die Tänzerin in eine Marionette, fremdbestimmt durch die Musik. Markus Lauterburg lässt archaische dunkle Klänge durch den Raum pulsieren, dann wieder sind die Töne schneidend aggressiv. All dies fügt sich zu einem Erinnerungsstück.
«Isabella» thematisiert die Auseinandersetzung mit Erfahrenem, das «Weiterleben nach einer seelischen Erschütterung», so ist aus dem Programmzettel zu erfahren. Doch eigentlich sollte man gar nicht so viel lesen, die Bilder sind aussagekräftig genug, und sie umfassen ein grossen Spektrum an Stimmungen, Temperamenten und Metaphern.
Beatrice Im Obersteg verwandelt sich mit der gleichen Leichtigkeit in ein schlüpfendes Insekt wie in eine hellenistische Statue. Eben noch krabbelte sie mit kantigen Bewegungen aus der schützenden Hülle, dann wieder zelebriert sie mit grösster Geschmeidigkeit klassische Posen. Ein furioser Schleiertanz endet beinahe in einer Textilschlacht. Der weich fliessende Stoff ist entweder Fessel oder schmeichelnde Hülle.
Nur einmal kippt die sorgfältig inszenierte Bildsprache beinahe in ihr Gegenteil, wenn Beatrice Im Obersteg mit einem Schirmskelett hantiert, von dem klirrend und funkelnd Glasscherben herunterregnen, ist das fast schon zu schön, fast schon zu sentimental, trivial.
Dem Gesamteindruck tut das keinen Abbruch. Die Professionalität beider Künstler, die Choreographie und Körperarbeit der Tänzerin, die Vielseitigkeit und Perfektion des Percussionisten, sie verbinden sich zu einem inspirierenden Abend.
Februar 16, 2010
Seitenblicke im Lagerhaus
Die aktuelle Ausstellung «Seh-Wechsel» vereint Aussenseiterkunst und zeitgenössische Kunst im Museum im Lagerhaus. Kategorien, die am Sonntag Gesprächsstoff gaben.
Was trennt, was verbindet die zeitgenössische bildende Kunst mit der Aussenseiterkunst? Wie empfinden die Künstler selbst diese Kategorisierung? Was bedeutet es für sie, einander gegenüberzustehen? Diesen Fragen stellten sich François Burland und Hildegard Spielhofer beim Künstlergespräch in der Reihe «KKK – Kunst-Kaffee-Kuchen» am vergangenen Sonntag im Museum im Lagerhaus. Den Rahmen bildete die aktuelle Ausstellung «Seh-Wechsel» mit den «Toys», den selbstgebauten Abfallobjekten Burlands, und der Fotoserie «Portobello» von Spielhofer.
Erstmals sind mit den Fotos einer gestrandeten Segelyacht Werke einer professionellen Künstlerin im Museum im Lagerhaus zu sehen. Und spätestens bei dieser Bezeichnung fangen die Schwierigkeiten schon an, die beim Gespräch untersucht wurden. Denn sind nicht auch die Aussenseiterkünstler auf ihre Weise professionell? Und was ist überhaupt ein Aussenseiterkünstler?
Museumsleiterin Monika Jagfeld wies gleich zu Beginn darauf hin, dass die Begriffe «Art brut», «Aussenseiterkunst» oder «Naive Kunst» stets von den Rezipienten geprägt wurden, nicht von den Künstlern selbst. Recht schnell wurde deutlich, dass vor allem die Kunsthistoriker die Abgrenzung suchen und Kategorien aufstellen. Die Künstler selbst kennen kaum Berührungsängste.
So auch beim aktuellen Beispiel. Beide empfinden die Ausstellung nicht als Konfrontation, sondern als bereichernd für das eigene Werk. So betonte etwa François Burland, dass er sowohl Thema als auch Technik im Werk Hildegard Spielhofers schätze und sich demnächst selbst mit der Kamera auf Wracksuche begeben möchte. Hildegard Spielhofer wiederum entdeckt ganz neue Seiten an ihrem Werk. Während bisher die Stimmung ihrer Bilder und die Inszenierung die Wahrnehmung dominierten, lassen sie sich in diesem Kontext plötzlich viel konkreter lesen, und es eröffnen sich völlig neue Assoziationsketten.
Spielhofer zeigte in ihrer Argumentation denn auch, dass sämtliche Kategorisierungen längst obsolet sind: «Es ist irrelevant, ob die Künstlerin Emma Kunz oder Fiona Tan heisst, wichtig sind die Intensität, die Hingabe und die Zeit, mit der gearbeitet wird. Der Wille muss erkennbar sein, etwas umsetzen zu wollen, ein Konzept oder ein Gefühl in Form zu bringen.»
Schöner lässt sich Kunst kaum definieren, und zwar unabhängig von irgendwelchen Kategorien. Oder wie es Burland formulierte: «Die Arbeit ist das Lebenselixier. Ein Werk ist für mich gut, wenn es belebt und beseelt ist. » Er selbst sieht sich überhaupt nicht als Spezialist, doch der müsse man auch nicht sein, um beispielsweise zu erkennen, ob ein Wein gut oder schlecht sei. Darin wurde nun doch noch ein markanter Unterschied zwischen beiden Künstlern deutlich: Im Gegensatz zu Spielhofer reflektiert Burland sein Schaffen nicht. Dass dies jedoch keine Qualitätseinbusse bedeuten muss, zeigt die Ausstellung eindringlich. Und sie eröffnet lohnenswerte Seitenblicke jenseits aller Etiketten. Dies funktionierte schon 2003 im Kunstmuseum, als sich Andy Warhol und die Appenzeller Bauernmalerei trafen; und nun setzt das Museum im Lagerhaus den Dialog fort.
November 26, 2009
Heimspiel im Galerieformat
Paul Hafner zeigt in seiner Galerie die Gruppenausstellung «Small talk» als Heimspiel der anderen Art. 19 Künstlerinnen und Künstler mit Verbindungen zu St. Gallen geben sich ein Stelldichein.
Paul Hafners Coup ist gelungen: Es gibt ein Heimspiel vor dem Heimspiel. Zwei Wochen bevor die Regionale im Kunstmuseum und der Kunsthalle St. Gallen eröffnet wird, zeigt der Galerist seine ganz individuelle Schau des Ostschweizer Kunstschaffens. Und die Auswahl kann sich sehen lassen. Sie reicht von etablierten Positionen bis hin zu jungen Künstlerinnen; von geborenen St. Gallern bis zu Künstlern, die aus Übersee in die Ostschweiz kamen oder bereits wieder weitergezogen sind. Nur fünf der 19 Präsentierten sind Künstler der Galerie, alle anderen geben ein Gastspiel.
Roman Signer beispielsweise. Er sagte sehr gern zu, und schon kurze Zeit darauf konnte Paul Hafner neue Arbeiten im Atelier abholen. Letzteres ist abgesehen vom Bezug der Künstler zur Ostschweiz ein gemeinsames Merkmal aller Werke: Der überwiegende Teil ist in diesem Jahr, ja für diese Ausstellung entstanden, die anderen sind höchstens ein Jahr älter.
Verständlich, dass Paul Hafner in der Ausstellung keine riesigen Bilder oder Installationen zeigt. Damit wäre eine nochmalige Reduktion der Auswahl nötig gewesen, die doch ohnehin schon nicht leicht zu treffen war. Und Qualität ist bekanntlich unabhängig von Zentimetern zu haben. Das gilt für die Gemälde von Andrea G. Corciulo ebenso wie für diejenigen von Vera Marke, für die Fotografien von Katalin Deér ebenso wie für die Inkjetprints von Ueli Alder.
Auch die für ihre Wandmalereien bekannte Marianne Rinderknecht hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auch im Kleinformat überzeugen kann. Die Hängung der Ausstellung mutet auf den ersten Blick wenig inspiriert an, folgt sie doch chronologisch den Geburtsjahren der Künstlerinnen und Künstler. Aber gerade darin offenbart sich dann wieder Interessantes.
So oszillieren Alex Hanimanns Zeichnungen zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit und thematisieren Ähnliches auf andere Weise wie direkt daneben Josef Felix Müllers «Abstrakte Malerei auf Holz»: Was man zunächst für drei Clownsmasken hält, wird durch den Titel zu rotem Punkt und Pinselstrich auf Weiss. Oder betrachten die Clowns Abstraktionen? Nein, sie betrachten den Betrachter solcherlei Malerei, oder?
Wenn in den Werken der älteren Künstler durchaus Ironie, Witz und spielerische Ideen anklingen, so wirken jene der jüngeren manchmal geradezu düster. Und noch etwas zeigt die chronologische Hängung: je jünger die Künstler, desto öfter klingt Bekanntes aus der Kunstgeschichte wieder an, wird umgedeutet oder aktualisiert. Beni Bischofs schwarze Gemälde etwa erinnern an die Ästhetik Pierre Soulages‘.
Die Lichtreflexe auf der satten Ölfarbe lenken den Blick auf die Farbstruktur und bei Bischof zusätzlich auf die inhaltlichen Finessen.
Mirjam Kradolfer schlüpft wie Cindy Sherman in unterschiedlichste Rollen, jedoch liegt der Schwerpunkt bei ihr auf der Körperhaltung und Gestik, sie benötigt damit weniger Requisiten und zeigt die Auswirkungen bereits kleinster Differenzierungen.
Michèlle Grob hingegen lädt ähnlich wie Thomas Ruff pornographisches Bildmaterial aus dem Internet herunter, allerdings verfremdet sie es nicht durch Vergrösserung, sondern durch die Übersetzung in Häkelei. Geschlechterklischees werden hier ebenso thematisiert wie der Kontrast der Medien.
Den Schlusspunkt der Ausstellung bildet Alexandra Maurers «la chute». Sie ist damit nicht der Chronologie untergeordnet, doch auch das hat seinen Grund: Der Fuss im Videostill wendet sich nach links und fordert somit auf, zurückzugehen und die Ausstellung nochmals abzuschreiten – in jedem Falle ist dies keine verschwendete Mühe.
November 12, 2009
Ordnung im Geräusche-Chaos
Sven Bösiger widmet sich mit «Meshology» der selbst erfundenen Wissenschaft vom Netzwerken. Im Ausstellungssaal von Katharinen sind die Ergebnisse seines Atelieraufenthaltes in Indien zu erleben.
Indien – es gibt wohl kaum einen, dem nicht sofort Bilder und Klänge durch den Kopf strömen beim Gedanken an dieses Land. Es spielt keine Rolle, ob man es selbst besucht hat oder nicht: Indien ist in unserer Vorstellung und Erinnerung präsent mit Farben, Gerüchen und Tönen. Deshalb rührt ein Gang durch die Ausstellung «Meshology» in Katharinen immer an Vertrautes inmitten des Fremden. Letzteres gibt es aber auch für routinierte Indienreisende noch zu entdecken. Denn Sven Bösiger richtet einen ganz individuellen Blick auf den Subkontinent.
Es ist der Blick eines sehr genauen, sehr aufmerksamen Beobachters, eines unvoreingenommenen und gleichermassen faszinierten Betrachters – oder besser gesagt: Zuhörers.
Der St. Galler weilte 2007 als ers- ter Künstler des neuen Artist-in-Residence-Programms der Stadt St. Gallen und der Konferenz der Schweizer Städte für Kulturfragen (KSK) in Varanasi und nutzte das halbe Jahr zudem zu einem von Süden nach Norden gerichteten Streifzug durch das Land. Es war sein erster Asienbesuch und nicht zuletzt darin bestand sowohl der Reiz als auch die Herausforderung. Bösiger hatte unzählige Eindrücke zu bewältigen und im wörtlichen Sinne zu verarbeiten.
Schnell zeigte sich für den Künstler, dass es wenig sinnvoll ist, einzelnes zu extrahieren, als vielmehr sich im Strom der visuellen und hörbaren Wahrnehmung treiben zu lassen, darin nach Orientierungslinien zu suchen und die Knotenpunkte des überaus komplexen Netzwerkes einzukreisen. Er findet sie sowohl an städtischen Plätzen wie auch mit einer Furt auf dem Lande oder sogar im Nachtzug Hyderabad–Kalkutta.
Siebenmal hat Bösiger Soundlinien verfolgt, siebenmal hat er die Schnittstellen des Tongefüges gefunden und macht sie nun für andere hörbar.
Kaum hat der Ausstellungsbesucher den Kopfhörer auf den Ohren, tauchen die eingangs erwähnten Bilder vor ihm auf. Er befindet sich in der Gasse in Varanasi, wo Silberfolienklopfer ihrer Arbeit nachgehen; er vernimmt einen Kuhhirten am Ufer des Tungrabadha. Er begibt sich zu den Cricketspielern in einem von Vögeln umschwärmten Park in Kalkutta oder in eine Gasse in Mysore, wo Blechteile sortiert werden. Bösigers Aufnahmen lassen einen tief in die ferne Welt eintauchen. Streift dann plötzlich der Blick die Fenster von Katharinen, erstaunt einen die menschenleere Gasse – erwartet man doch eben jene Betriebsamkeit, die einem gerade entgegenschepperte, -rasselte, -dröhnte oder -hupte.
Sven Bösigers Fokus liegt klar im Auditiven. Und doch gelingt es ihm, in der Installation auch ein visuell stimmiges Bild zu vermitteln. Die Kabel der sieben Kopfhörer und Abspielgeräte sind wie eine Zeichnung in den Raum gelegt. Sie verknäueln sich, laufen parallel oder kreuz und quer, so dass ein komplexes Netzwerk entsteht, das seine Entsprechung sowohl in den von Bösiger vorgefundenen Soundknoten findet als auch in dem typisch indischen Oberleitungsgewirr. Zusätzlich erwarten den Ausstellungsbesucher sechs grossformatige Fotografien, die nicht einfach die sieben Stationen illustrieren, sondern Atmosphäre vermitteln wollen und sowohl die ruhigen wie auch die betriebsamen Seiten Indiens zeigen. Detailliertere Informationen zu den Tonszenarien sind dagegen aus einem Beiblatt zu erfahren, doch es empfiehlt sich durchaus, sich erst einmal ganz unvorbereitet die Kopfhörer aufzusetzen und es so zu machen wie Bösiger selbst: sich öffnen, passieren lassen und die Kraft der Bilder auskosten.
November 1, 2009
Die Zerstörung der Zerstörung
Das Kunstmuseum Liechtenstein zeigt die Gruppenausstellung „Moderne als Ruine. Eine Archäologie der Gegenwart“
Ein Mann bricht aus – raus aus der täglichen Routine, den herkömmlichen Beziehungsgeflechten. Er vermauert seine Wohnungstür und schlägt ein Loch in die Wand des Mietshauses. In dieser Höhle haust er abseits aller geltenden zivilisatorischen Regeln. «Themroc» mit Michel Piccoli in der Hauptrolle spielt die Idee des Aussteigers in einem gewagten Szenario durch. Statt der Flucht in exotische Ferne, auf einsame Inseln oder in halluzinatorische Geisteswelten bleibt der Protagonist in seiner bisherigen Lebenswelt und wirft dort alle Zwänge ab.
Es ist kein Zufall, dass die Zerstörung des Mietshauses das deutlichste, das sichtbarste Zeichen für diese Absage an die tradierten und allgemein etablierten Lebensformen ist. Mit dem Mietshaus verbinden sich unzählige Geschichten, Zwänge, Klischees, aber auch Hoffnungen, Utopien. Immer wieder traten Architekten an, um es zu revolutionieren, menschlicher oder besonders bewohnenswert zu machen. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Zersiedlung der ländlichen Gebiete oder der Übervölkerung der Städte ist das Mietshaus wieder im Fokus. Doch was ist geworden aus den Utopien eines LeCorbusier oder Mies van der Rohe? Was aus den Planstädten und Plattensiedlungen? In welchen Umständen lebt die Mehrzahl der Menschen weltweit?
Mit diesen Fragen setzen sich nicht nur Stadtplaner und Architekten auseinander. Seit einigen Jahrzehnten sind sie immer wieder auch und besonders für Künstler von grossem Interesse. Einer von ihnen war der Amerikaner Gordon Matta-Clark. Er verstarb 1978 mit nur 35 Jahren und hatte bereits Werke von grosser Ausdruckskraft und nachhaltiger Wirkung entwickelt. So zerschnitt er etwa mit der Motorsäge Fassaden, Decken und Böden von bestehenden Gebäuden und schuf damit angewandte Architekturkritik: Seine Arbeiten treten für eine Anarchitecture ein, ein anarchistisches Unterwandern des architektonischen Kanons, wie auch für das Non-Ument, das dem Prozesshaften den Vorzug gibt gegenüber dem Bestehenden. Matta-Clark reflektiert das Temporäre von Architektur. Ein Beispiel dafür ist «Conical Intersect»: In ein zum Abriss vorgesehenes Haus neben dem im Bau befindlichen Centre Pompidou schnitt Matta-Clark ein Loch, durch das man nicht nur hindurch sehen konnte, sondern das auch das Innere des Hauses, seine Geschichte und Struktur öffentlich machte. Die Zerstörung als kreativer Akt geht der eigentlichen Zerstörung voraus, die in diesem Fall durchaus nicht unumstritten war, mussten doch für das Pariser Kulturzentrum Teile des alten Marais-Viertels weichen.
Jedes Bauen verändert die räumlichen Zusammenhänge und kann damit sowohl bereichernd als auch zerstörerisch wirken, letztgenanntes wirkt sich dabei nicht nur auf die Gebäude oder die städtischen Strukturen selbst aus, sondern hat mitunter weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen. Künstlern, die ihr Augenmerk darauf lenken, ist die Ausstellung «Die Moderne als Ruine. Eine Archäologie der Gegenwart» gewidmet, die nach der Generali Foundation in Wien nun im Kunstmuseum Liechtenstein zu sehen ist.
Gordon Matta-Clark ist mit sechs wichtigen filmischen Arbeiten in der Ausstellung präsent. Er gehört mit Robert Smithson, Iza Genzken, Dan Graham und Yona Friedmann zu den bereits als klassisch zu bezeichnenden Positionen. Smithson ist unter anderem mit seiner wunderbaren Arbeit «Hotel Palenque» vertreten, einem Diavortrag, der ein im Bau befindliches, aber doch schon wieder verfallenes Hotel in Mexiko auf ebenso eingehende wie amüsante Weise untersucht. Von Yona Friedmann sind drei seiner fragilen Stadtmodelle aus Abfallmaterialien zu sehen. Friedmann stellt die Frage nach dem Vorhandensein und Verfügbarkeit der Ressourcen. Er thematisiert unsere illusionistischen Ansichten über deren Verteilung und die unzulängliche globale Kommunikation darüber. Ein Aspekt dieser Verteilung zeigt sich in der Arbeit «Bantar Gebang» von Jeroen de Rijke und Willem de Rooij. Zehn Minuten lang wird der Betrachter Zeuge des Sonnenaufgangs über einem Slum auf einer indischen Müllhalde. Selbst wenn man diesem Film mit seiner subtilen Farbigkeit und seinem wohltuenden Verweilen bei einer Kameraeinstellung eine ästhetische Komponente abgewinnen kann, ist die Szenerie bedrückend. Etwaige Diskussionen um die ideale Wohnform für den zeitgenössischen Stadtbewohner, oder gar um Flach- oder Spitzdächer erscheinen müssig, solange nicht einmal die elementarsten Bedürfnisse des Menschen befriedigt sind und obendrein der Umgang mit den Ressourcen noch immer derart problematisch ist. De Rijke und de Rooij gehören zu den jüngeren Positionen in der Ausstellung, daneben sind Giuseppe Gabellone, Cyprien Gaillard, Florian Pumhösl und Rob Voerman zu nennen. Letzterer ist mit grossformatigen Zeichnungen sowie einem seiner heterotopischen Bauten vertreten – einer Mischung aus Behausung, Höhle und Urhütte. Stephen Willats schliesslich analysiert in «Wie ich meine Fluchtwege organisiere» die Schrebergartenwelt als Gegenentwurf zum Mietshaus: Idylle kontra Normierung.
September 4, 2009
Augenreisen
Landschaft als Realität – aber auch als Phantasie und Projektion: Dies zeichnet die Malerei der Niederländer aus. Das Kunstmuseum St. Gallen lädt zur Zeitreise ein, mit Blättern aus der eigenen Sammlung und aus einer hochkarätigen Schweizer Privatsammlung.
Jeder Blick ist eine Reise, jeder Schritt eine Wanderung. Die niederländischen Landschaften des 16. und 17. Jahrhunderts eröffnen dem Betrachter ein unermessliches Spektrum an Ausblicken, Ansichten und Schauplätzen, jenseits der Klischees von Windmühlen, Alleen und Grachten. Die gibt es freilich auch, ebenso die Marinedarstellungen und die typischen Stadtansichten mit Giebelhäusern. Doch die Ausstellung «Phantasien – Topografien» im St. Galler Kunstmuseum zeigt, dass dies nur ein Teilaspekt der holländischen Landschaft ist.
Bereits der Titel verweist auf das Spannungsfeld von Erdachtem und Gesehenem. Hinzu kommt Überliefertes durch Grafik-Editionen, Künstlerberichte und Sammlungen. Die Holländer hatten schon früh regen Kontakt nach Italien. Künstler und Sammler jenseits der Alpen zeigten ausserordentliches Interesse an den naturnahen, sorgfältig beobachteten Darstellungen holländischer Renaissancemeister.
Im 16. und 17. Jahrhundert kehrt sich dies um, und Italien wird zum Sehnsuchtsziel der Nordländer. So überrascht es nicht, zahlreiche italienische Motive zu finden. Nicht zu vergessen die Gebirge. So wird von Pieter Breughel d. Ä. berichtet, er habe, auf der Rückreise von Italien die Berge und Felsen der Alpen verschluckt und sie auf Leinwände und Malbretter wieder ausgespien. Er wird zum grossen Erneuerer der niederländischen Landschaftsdarstellung mit seinem Fokus auf die Lebenswirklichkeit. In der Ausstellung kündet davon etwa Breughels Blatt einer Landschaft mit rastenden Soldaten.
Andere grosse Namen fehlen ebenfalls nicht; so ist Rembrandt mit einer Serie von Ansichten des Amsterdamer Umlandes vertreten, Hans Bol mit seinen Dorflandschaften, von Jan van de Velde ist ein Monatszyklus zu sehen, von seinem Bruder Essaias ländliche Motive. Letzterer ist in der Sammlung mit zwei wichtigen Frühwerken vertreten, die hier in völlig neuem Licht erscheinen, da deutlich wird, wie die in der Grafik erprobten Kompositionen in die Malerei übertragen werden.
Gemälde aus der Sammlung des Kunstmuseums stellen nur einen kleinen Teil der Präsentation dar. Den Hauptanteil machen Arbeiten auf Papier aus einer Schweizer Privatsammlung aus, die sich durchaus messen kann mit dem, was in den Grafikkabinetten grosser europäischer Museen aufbewahrt wird.
Dies gilt zum einen für die Künstler: So zählt die Sammlung hervorragende Blätter aus dem äusserst schmalen gezeichneten und druckgrafischen Werk von Jacob van Ruisdael zum Bestand. Zum anderen ist die Qualität bemerkenswert. Es handelt sich ausnahmslos um frühe Abzüge, erkennbar am satten Schwarz und den feinen Lineaturen.
Die Zeichnungen wiederum sind weit mehr als Handskizzen, es handelt sich oft um bildhaft ausgeführte Werke, die für den damaligen Sammler bestimmt waren. So bei Jan van Goyen und Pieter Molyn, zwei Repräsentanten der sogenannten tonalen Phase. Letztere beruht auf der Erkenntnis, dass Licht und Atmosphäre die Eigenfarbe der Dinge zurückdrängen zugunsten einer homogenen Erscheinungsfarbe.
Die ungefähr 250 Werke laden zu Augenreisen ein, die Kenner wie Flaneure in ihren Bann ziehen. Letztere werden ihr Schritttempo mässigen, um in eins ums andere Blatt eintauchen zu können. Es lohnt sich drum, Zeit mit in die von Matthias Wolgemuth kuratierte Ausstellung zu bringen.